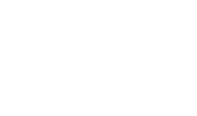Christopher Seiberlich

Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Professur für Neueste Geschichte und Zeitgeschichte
Historisches Seminar
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Wissenschaftlicher Werdegang
| 2022 | Gastwissenschaftler am Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia, Stockholms Universitet |
| Seit 2021 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand, Professur für Neueste Geschichte und Zeitgeschichte, Universität Freiburg (Prof. Dr. Jan Eckel); finanziert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft |
| 2017 - 2021 | Doktorand am Seminar für Zeitgeschichte, Universität Tübingen (Prof. Dr. Jan Eckel) |
| 2016 - 2017 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Neueren deutschen Literatur, Universität Freiburg (Prof. Dr. Achim Aurnhammer) |
| 2016 |
Staatsexamen in Geschichte und Germanistik an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg |
| 2013 | Studium der Geschichte, Germanistik und Theaterstudien an der Göteborgs Universitet |
|
2014-2016 |
Studium der Geschichte, Germanistik und Lateinischen Philologie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg |
|
2014-2016 |
Tutor für Alte Geschichte, studentische Hilfskraft in der Neueren deutschen Literatur sowie Mentor für die Staatsexamensvorbereitung in der Neueren deutschen Literatur |
Stipendien
| 2019-2021 | Promotionsstipendiat der Friedrich-Ebert-Stiftung |
| 2012-2016 | Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes |
Forschung
Aktuelle Projekte
(English version below)
Dissertationsprojekt:
Die Sozialdemokratie und die postkoloniale Ordnung der Welt (Arbeitstitel)
Betreuer: Prof. Dr. Jan Eckel
Zwischen 1969 und 1974 wurden in Europa neun sozialdemokratisch geführte Regierungen gebildet, die allesamt eine außenpolitische Erneuerung proklamierten, den Willen zur Übernahme »internationaler Verantwortung« bekundeten und mit der bisherigen Außenpolitik ihrer Länder brachen. Als besonders wichtiges Feld der Profilierung und Neuausrichtung stellte sich die Politik gegenüber dem globalen Süden heraus.
Das Dissertationsprojekt möchte erforschen, wie Regierungen in den »langen siebziger Jahren« sozialdemokratische Außenpolitik neu gestalteten, indem sie sich mit den Themen und Problemen der entstehenden postkolonialen Ordnung auseinandersetzten. Hierzu untersucht es die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, der Niederlande und Schwedens von 1969 bis in die frühen 1980er Jahre anhand des Ringens um eine neue Weltwirtschaftsordnung und anhand der Politik gegenüber dem südlichen Afrika. Die Dissertation fragt nach gewandelten Diagnosen und Beobachtungen, aus denen sich die außenpolitischen Aufbrüche speisten, nach der Übersetzung dieser Ideen in politisches Handeln sowie nach den Wirkungen, Folgen und Reichweiten der Außenpolitik.
Das Promotionsvorhaben verbindet die Geschichte der Sozialdemokratie mit der Geschichte der Nord-Süd-Beziehungen. Darüber hinaus leistet es einen Beitrag zu Diskussionen über die Transformation der internationalen Ordnung seit den 1970er Jahren, indem es neu entstehende Politikfelder, Veränderungen im Auftreten und der medialen Inszenierung außenpolitischer Akteure sowie die Überlagerung von Kaltem Krieg und Dekolonisierung beleuchtet. Schließlich trägt das Projekt zur Verortung der 1970er und 1980er Jahre in der Zeitgeschichte bei, indem es Annahmen über den »Beginn der Gegenwart« überprüft, vergangene Zukunftsvorstellungen analysiert und zeitgenössisch denkbare, aber »abgebrochene Wege« in die Zukunft offenlegt.
PhD Project
Social Democracy and the postcolonial world order (working title)
Advisor: Prof. Dr. Jan Eckel
Within a few years after 1969, seven social democratic parties assumed power in Europe, setting out to forge ambitious new programs for their countries’ foreign policies. For the first time since the Second World War, these countries now possessed a social democratic foreign policy that moreover broke with long-standing national traditions of navigating international affairs. On the one hand, the new departures in foreign policy responded to what policymakers saw as a rapidly changing global situation. Détente appeared to overcome the „Cold War”, the growing „interdependence” of world regions put new global problems on the agenda, the Bretton Woods system was about to dissolve and decolonization had produced numerous new states that established themselves as influential actors on the international stage. On the other hand, social democratic governments were determined to take advantage of this perceived moment of fluidity in order to shape the international system according to their visions. In their eyes, developing a forward-looking relationship with the global South represented one of the most significant tasks in this endeavor.
This project examines how these governments created a new social democratic foreign policy during the 1970s and 1980s by means of confronting the problems of the emerging postcolonial order. It focuses on three particular governments and their policies in two important fields, studying the West German, Dutch, and Swedish roles in the debates on the creation of a „New International Economic Order” and their attitudes toward colonial or minority rule and liberation movements in Southern Africa. Resolving both issues was widely seen as essential for the future of both social democracy and international politics. The project will study how the ideas for a new social democratic foreign policy emerged, how governments put them into practice, and what results these new approaches yielded.
The study proposed here will connect the history of social democracy and the history of what contemporaries termed the conflict between „North” and „South”. It strives to expand our knowledge on three levels: Firstly, the project highlights Social Democracy as a crucial actor in international affairs and, at the same time, foreign policy as an important field of Social Democratic action, combining two aspects that have received scant attention among historians. Secondly, the project contributes to exploring the transformation of the international order during the 1970s and 1980s. Thirdly, it seeks to nuance our understanding of these decades as the „beginning of our present” by emphasizing contemporaries’ expectations of and attempts to bring about a more just and equal world order than the one that subsequently emerged.
Publikationen, Vorträge und Workshops
Aufsätze
- No Peace without Equality. The ‚North-South Conflict‘ and Its Effects on Sweden, the Netherlands and West Germany, in: Nevra Biltekin/Leos Müller/Magnus Petersson (Hrsg.): 200 Years of Peace. New Perspectives on Modern Swedish Foreign Policy, New York/Oxford 2022, S. 134-160.
- »Ausgleich zu Hause und draußen«. Solidaritätsrhetorik und die Neukonzeption der westdeutschen und schwedischen Außenpolitik in den 1970er-Jahren, in: Archiv für Sozialgeschichte 60 (2020), S. 213–235.
Rezensionen
-
Rezension zu: Bernd Rother: Sozialdemokratie global. Willy Brandt und die Sozialistische Internationale in Lateinamerika (Willy Brandt – Studien und Dokumente), Frankfurt am Main 2022, in: H-Soz-Kult, 28.10.20222.
-
Rezension zu: Sara Lorenzini: Global Development. A Cold War History, Princeton / Oxford 2019, in: sehepunkte 21 (2021), Nr. 63.
-
Rezension zu: Steffen Fiebrig / Jürgen Dinkel / Frank Reichherzer (Hrsg.): Nord/Süd. Perspektiven auf eine globale Konstellation. Berlin / Boston 2020, in: sehepunkte 21 (2021), Nr. 44.
-
Rezension zu: Rother, Bernd; Larres, Klaus (Hrsg.): Willy Brandt and International Relations. Europe, the USA, and Latin America, 1974-1992. London 2018, in: H-Soz-Kult, 04.06.20195.
Tagungsberichte
-
Solidarity and Humanitarianism in the Global South between Decolonization and the Cold War (1960s-1980s), Berlin 28.-29.09.2020, in: H-Soz-Kult, 20.11.20206.
-
Perceptions of Apartheid in Western Europe 1960-1990, Hamburg 13.-15.09.2018, in: H-Soz-Kult, 07.11.20187.
-
Dieser Tagungsbericht ist in deutscher Übersetzung erschienen: Perceptions of Apartheid in Western Europe 1960-1990, in: Zeitgeschichte in Hamburg 2018, hrsg. von der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg, Hamburg 2019, S. 100-108.
Vorträge
- Ausgleich zwischen arm und reich oder Kampf um Einfluss und Ressourcen? Rolle und Beitrag der Bundesrepublik in den Nord-Süd-Beziehungen. Kanzlerwechsel 1974. Die Bundesrepublik zwischen Reformpolitik und Krisenmanagement, Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung und der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung, 25./26. April 2024. Aufzeichnung hier abrufbar8
- Zwischen Vision und Realität. Die europäische Sozialdemokratie und der Nord-Süd-Konflikt. 15. Österreichischer Zeitgeschichtetag in Graz, 11.-13. April 2024.
-
Gewalt durch Gewalt beenden? Die Bundesrepublik und „Befreiungsbewegungen“ in Rhodesien 1977. Workshop “Cold War Studies”, Berliner Kolleg Kalter Krieg: 22./23. März 2023.
-
Socialdemokratin och världens postkoloniala nyordning. Seminar i IR historia, Hans Blix Centrum, Stockholms Universitet: 27. April 2022.
- Looking South. European Social Democrats and the production of knowledge about the »Global South« in the years of détente. European Summer School on the Global Cold War 2021, Utrecht University: 03. September 2021.
- „Lieblinge der Dritten Welt“ und „Sittenwächter der Marktwirtschaft“. Sozialdemokratische Außenpolitik und die postkoloniale Ordnung der Welt in den 1970er Jahren. Forschungskolloquium zur Neueren und Neuesten Geschichte Universität Göttingen: 17. Juni 2021.
- Envisioning a postcolonial world order. Social Democratic relations with the Global South in the 1970s. Alternative Visions of Europe in the 1970s (Plusieurs). European University Institute & Academy of Finland: 04. Februar 2021.
- „Sittenwächter der Marktwirtschaft“ und „Lieblinge der Dritten Welt“. Sozialdemokratische Außenpolitik, die Neue Weltwirtschaftsordnung und die postkoloniale Ordnung der Welt in den 1970er Jahren. Kolloquium zur Geschichte Westeuropas und der transatlantischen Beziehungen, HU Berlin: 19. Januar 2021.
- Die globale soziale Frage. Sozialdemokratische „Nord-Süd-Politik“ in der Bundesrepublik, Schweden und den Niederlanden von 1969 bis in die frühen 1980er Jahre. Öffentlicher Vortrag im Rahmen des Kolloquiums des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin und der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung: 17. November 2020. Aufzeichnung hier abrufbar9.
-
Equality for Peace. The »North-South Conflict« and Social Democratic Foreign Policy in West Germany, the Netherlands and Sweden. Conference 200 Years of Peace in Sweden. Stockholm University & The Swedish National Archives: 16. April 2020.
- „Ausgleich zuhause und draußen“. Die Solidaritätsrhetorik in der bundesdeutschen und schwedischen Außenpolitik der 1970er Jahre. Autor*innen-Workshop des Archivs für Sozialgeschichte: 17. Oktober 2019.
-
Die Sozialdemokratie und die postkoloniale Ordnung der Welt. Projektvorstellung. Kolloquium zur Neuesten und Zeitgeschichte Universität Halle-Wittenberg; 07. Juni 2018.
Lehrveranstaltungen und Workshops
Lehrveranstaltungen
- Sommersemester 2024: Übung: »Ein Volk der guten Nachbarn?« Die Bundesrepublik Deutschland in der Welt
-
Wintersemester 2023/2024: Übung: »Nord« und »Süd« seit der Dekolonisierung
Workshoporganisation
- Gemeinsam mit Peter Beule, Sandra Funck, Stefan Müller und Stefan Weise: Does History Matter? Workshop zur Vergangenheit und Gegenwart der Sozialen Demokratie, 11./12. Februar 2021. [Archiv der Sozialen Demokratie und Studienförderung der Friedrich-Ebert-Stiftung]